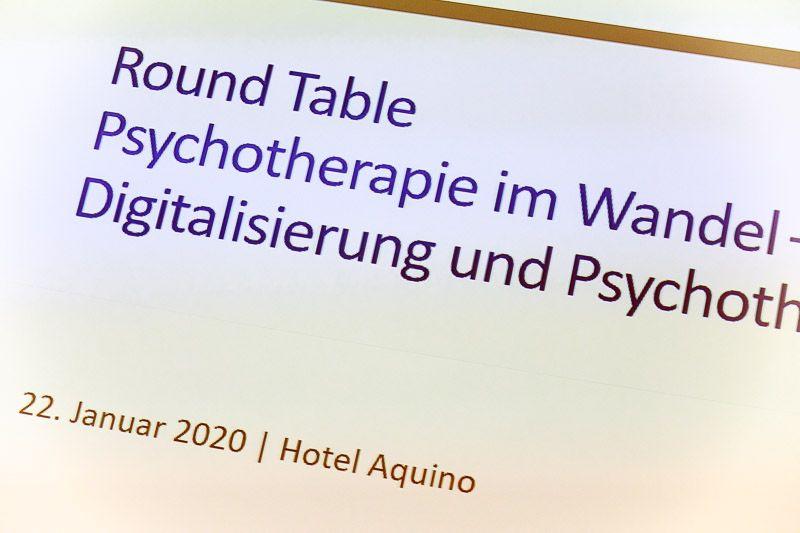Technologischer Fortschritt und schnelle Heilsversprechungen
BPtK-Round-Table: Psychotherapie im Wandel
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens wird die psychotherapeutische Arbeit verändern. Die Verordnung von Gesundheits-Apps ist ebenso wie die Online-Behandlung per Video bereits rechtlich geregelt. Der Profession stellen sich dabei auch grundsätzliche Fragen, zum Beispiel: „Wie wirken sich digitale Anwendungen auf das Verhältnis zwischen Psychotherapeut*innen und Patient*innen aus?“, „Wie verändert sich die psychotherapeutische Versorgung durch die Digitalisierung?“, „Verändert die Digitalisierung das Selbstbild der Menschen und ihre Beziehungen zu anderen?“ und ,„Wie sieht das Berufsbild der Psychotherapeut*innen in Zukunft aus?“.
BPtK-Präsident Dr. Dietrich Munz betonte, wie sehr das Thema die BPtK beschäftige. Im vergangenen Jahr habe insbesondere das Digitale-Versorgung-Gesetz im Vordergrund gestanden, mit dem Gesundheits-Apps in die Regelversorgung integriert wurden. Es sei erreicht worden, dass auch Psychotherapeut*innen künftig solche digitalen Produkte verordnen und in ihrer Behandlung einsetzen können. Dafür habe sich die BPtK lange eingesetzt. Aktuell liege die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) dazu vor, in der die Vorgaben zum Verfahren und zu den Anforderungen für die Zulassung der Apps konkretisiert würden. Von besonderer Bedeutung für die Psychotherapeut*innen sei außerdem, dass seit Oktober 2019 auch eine Online-Behandlung per Video von den Krankenkassen übernommen werde.
Digitalisierung und Einstellungen von Patient*innen
BPtK-Vizepräsident Dr. Nikolaus Melcop ging in seinem Vortrag der Frage nach, wie sich die Digitalisierung auf Einstellungen und Erwartungen von Patient*innen auswirkt. Er betonte, dass Digitalisierung zunehmend unseren Alltag verändere und nicht nur im Gesundheitssystem immer neue Fragen aufwerfe. Dabei werde das Thema Digitalisierung von vielen Prophezeiungen, utopischen wie dystopischen, begleitet.
Das Internet, das 84 Prozent der Bevölkerung nutzt, habe sich weitgehend durchgesetzt.. Der Anteil der Internetnutzer*innen sei über die Jahre hinweg kontinuierlich gestiegen und liege bei Jüngeren bereits stabil bei 100 Prozent. Aber auch Kinder zwischen zwei und sechs Jahren nutzten bereits regelmäßig verschiedene digitale Medien. Mit zunehmenden Alter sei dann insbesondere das Smartphone für Kinder und Jugendliche ein ständiger Begleiter. Die Mediennutzung überschreite regelmäßig die Empfehlungen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das sei das Ergebnis einer Studie im Auftrag des BMG, die auch die psychischen Auswirkungen der Digitalisierung bei Kindern und Jugendlichen untersucht habe. Dabei zeigte sich, dass eine intensive Nutzung digitaler Medien mit Entwicklungsauffälligkeiten, wie beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten, sprachlichen Schwächen oder Hyperaktivität, zusammenhänge.
Psychotherapiepatient*innen wüchsen zunehmend in einer digitalen Welt auf oder – wenn sie noch nicht darin aufgewachsen sind – bewegten sich heute in ihrem Alltag darin. Deshalb stelle sich die Frage, welche Botschaften eine digitale Welt vermittle und welche Einstellungen und Erwartungen sie forme. Dieser Frage sei auch Dr. Alexandra Borchardt in ihrem Buch „Mensch 4.0“ nachgegangen. Sie komme zu dem Schluss, dass die Digitalisierung die Individualisierung vorantreibe. Insbesondere das allzeit verfügbare Smartphone suggeriere, dass alles sofort möglich sei.
Der Soziologe Andreas Reckwitz habe in seinem Buch „Die Gesellschaft der Singularitäten“ untersucht, wie sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts unsere Gesellschaft und die Menschen durch einen Prozess der Singularisierung verändern. Dazu gehöre insbesondere die Verschiebung der leitenden sozialen Logik von Erwartungen des Allgemeinen zu Erwartungen des Besonderen. Reckwitz beschreibe, dass Technik und Technologie, über die eine Gesellschaft verfüge, entscheidend beeinflusse, wie Menschen handeln und fühlen, wie sie kommunizieren und imaginieren und wie sie produzieren und herrschen. Er beschreibe eine gesellschaftliche Entwicklung, in der die kapitalistische Singularisierung der Arbeitswelt überlagert werde von neuen kulturellen Märkten der Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die insbesondere über die digitalen Medien geschaffen werden. Dies aber führe zum neuen kulturellen Primat des Besonderen, das entscheidend von der Bereicherung und Aufwertung des Selbst geprägt sei.
Melcop beschrieb danach, welche Erwartungen Patient*innen an die Digitalisierung des Gesundheitswesens haben. Eine qualitative Untersuchung im Auftrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung zeige, dass Patient*innen dieser gegenüber sehr aufgeschlossen seien: Sie nutzen regelmäßig das Internet für Gesundheitsfragen, wünschten sich Gesundheits-Apps auf Rezept, sprechen sich für digitale Bescheinigungen der Arbeitsunfähigkeit aus und können sich häufig auch vorstellen, Online-Sprechstunden per Video zu nutzen, neben denen aber immer auch ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht möglich bleiben soll. Einige fordern offensiv die Einführung einer digitalen Patientenakte und wünschen sich, dass Ärzt*innen Künstliche Intelligenz in ihre Entscheidungen einbeziehen. Gleichzeitig besteht beständig die Sorge um die Sicherheit und den Schutz der eigenen Gesundheitsdaten.
Abschließend betonte Melcop die besondere Relevanz der Datensicherheit. Der Publizist Evgeny Morozov gehe davon aus, dass technologische Entwicklungen immer die Folge von fundamentalen Kräften seien, die in Begriffen von Macht, Kapital und staatlicher Verfügungsgewalt beschrieben werden könnten. Dabei sei aber die Technologie selber nie die Treibkraft. Sie folge keiner autonomen Logik. Hinter spezifischen Technologieeffekten ständen historisch gewachsene Machtstrukturen, die auch wieder verändert werden könnten.
Melcop erwartete, dass Psychotherapiepatient*innen, die in einer digitalisierten Welt aufgewachsen seien, auch bereit wären, digitale Anwendungen für ihre Gesundheit zu nutzen. Sie würden deshalb auch von ihren Psychotherapeut*innen entsprechende Kompetenzen erwarten. Dabei bleibe ihnen aber die unmittelbare menschliche Interaktion wichtig, die nicht zu ersetzen sei. Besonderen Wert legten sie auf Datenschutz und Vertraulichkeit.
Digitalisierung und psychotherapeutische Arbeit
Prof. Dr. Johanna Böttcher von der Psychologischen Hochschule Berlin gab einen Überblick über die Forschungsergebnisse zur psychotherapeutischen Versorgung per Internet. Weniger als ein Viertel der Menschen mit psychischen Erkrankungen nähme eine psychotherapeutische Behandlung in Anspruch. Dies könne zum einen an der zu geringen Anzahl an Praxen und Behandlungsplätzen liegen, aber auch daran, dass viele Menschen durch das Aufsuchen einer Psychotherapeut*in eine Stigmatisierung befürchteten. Dies sei bei Online-Therapien nicht so. Außerdem könnten sie räumliche und zeitliche Barrieren überwinden, wenn die Wege zur Praxis zu weit seien oder die Psychotherapie nur schwer in den Arbeitsalltag passe.
Nach Böttcher belegten zahlreiche nationale und internationale Studien die Wirksamkeit von Online-Therapie. Die meisten Programme basierten auf kognitiv-verhaltenstherapeutischen Konzepten, es seien aber auch erste psychodynamische Programme verfügbar. Es stelle sich insbesondere die Frage nach der individuellen Indikation, also für welche Patient*innen eine Online-Therapie passend sei ist. Die typische Annahme über die Patient*in in einer Online-Therapie sei, dass diese jung, gebildet, nicht sehr eingeschränkt, motiviert und technikaffin sei.
Diesen Annahmen widmete sich Böttcher ausführlicher in ihrem Vortrag. Vier Studien deuteten darauf hin, dass schwer belastete Patient*innen besser von Online-Therapien profitierten als weniger schwer belastete. Der Bildungsabschluss sei bislang auch nicht als Kriterium für den Behandlungserfolg belegbar. Erste Hinweise lägen dafür vor, dass ältere Patient*innen eher als jüngere von Online-Therapien profitierten, vermutlich weil sie diese häufiger bis zum Ende durchführten. In drei Studien habe sich auch kein Einfluss der technischen Versiertheit der Patient*in auf den Behandlungserfolg gezeigt. Fünf Studien konnten belegen, dass die Motivation einen Einfluss auf die Adhärenz habe.
Neben vielen Studien, die die Wirksamkeit von Online-Therapien belegten, lägen mittlerweile auch erste Ergebnisse zu negativen Effekten in der Online-Therapie vor. Vier bis sechs Prozent der Patient*innen erlebten eine reliable Verschlechterung und bis zu 14 Prozent berichteten über andere Nebenwirkungen. Zu den spezifischen Nebenwirkungen der Online-Therapie zählten beispielsweise Zeitdruck, das Gefühl zu versagen oder eine mangelhafte Verständlichkeit der Inhalte.
Abschließend verwies Böttcher auf das gemeinsam mit der BPtK geplante Forschungsprojekt. Darin sollen störungs- und verfahrensübergreifende Therapie-Module weiterentwickelt werden, indem die Perspektive von Patient*innen und Psychotherapeut*innen einbezogen wird. Dadurch könnten die Online-Module optimal an die Anforderungen von ambulanter Psychotherapie angepasst werden.
Die verhaltenstherapeutische Sicht
Sabine Maur, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz, beschrieb die Digitalisierung der psychotherapeutischen Versorgung aus verhaltenstherapeutischer Sicht. Unter dem Begriff der „internet- und mobilbasierten Interventionen“ (IMI) könnten Apps und digitale Anwendungen summiert werden, die nach der Komplexität ihrer Inhalte, der erforderlichen Begleitung, dem Ausmaß der technischen Innovation und der Sensibilität der Daten unterschieden werden könnten. Unterschieden werden müsse auch zwischen einfachen digitalen Angeboten, die lediglich einen Ersatz für „Papier und Bleistift“ darstellten und umfassenden Behandlungsprogrammen. Viele digitale Angebote beruhten auf verhaltenstherapeutischen Prinzipien, zu deren typischen Bestandteilen z. B. Psychoedukation, Datenerhebung, Verlaufsdiagnostik und Feedback an die Therapeut*in, Therapieaufgaben/Alltagstransfer und Trainingselemente gehörten.
Allein die bloße Aneinanderreihung verhaltenstherapeutischer „Interventionen“ sei aber noch keine Verhaltenstherapie. Zentral sei deshalb, dass IMIs in eine Psychotherapie eingebettet werden. IMIs seien erfolgreicher, wenn sie psychotherapeutisch begleitet würden. Studien hätten aber auch zeigen können, dass die therapeutische Allianz bei digitalen Angeboten besser als erwartet sei.
Als neue innovative digitale Angebote stellte sie eine App zur Veränderungserkennung bei bipolaren Störungen vor sowie Virtual-Reality-Brillen, die für die Behandlung von Angststörungen gedacht seien, und Serious Games, die in einer spielerischen Umgebung therapeutische Inhalte vermitteln und insbesondere für Kinder und Jugendliche entwickelt worden seien.
Eine Umfrage der Landespsychotherapeutenkammer Rheinland-Pfalz habe ergeben, dass Psychotherapeut*innen ein großes Informationsbedürfnis in Bezug auf online-basierte Interventionen und Apps für die Behandlung psychisch kranker Menschen hätten. Fast drei Viertel der Befragten wünschten sich mehr Informationen zu diesem Thema. Gleichzeitig bestünde bei nahezu zwei Dritteln grundsätzlich die Bereitschaft, digitale Angebote in die Therapie zu integrieren.
Abschließend betonte Maur, dass die Digitalisierung die analoge Versorgungsvielfalt nicht ersetzen könne. Die Implementierung müsse an Nutzer*innen und Behandler*innen orientiert sein. Hinsichtlich Wirksamkeit, Datensicherheit und Ethik müssten Standards entwickelt werden und außerdem sei eine Qualifizierungsstrategie für Psychotherapeut*innen notwendig.
Die psychodynamische Sicht
Roman Rudyk, Präsident der Landespsychotherapeutenkammer Niedersachsen, schilderte seine persönliche Sicht darauf, wie sich die Digitalisierung auf die psychotherapeutische Versorgung aus psychodynamischer Sicht auswirke. Er beschrieb, welche Erfahrungen es bereits mit analytischen Psychotherapien über Medien gebe. Es bestünde die Möglichkeit, Analysen, Lehranalysen und Supervisionen per Telefon durchzuführen. Diese Möglichkeit werde auch genutzt. Schon 1951 sei erstmals von analytischen Sitzungen über das Telefon berichtet worden. Geforscht worden sei dazu jedoch verhältnismäßig wenig. Heute gebe es einzelne Untersuchungen zum Thema, beispielsweise zu psychoanalytischer Gruppenpsychotherapie als Kurzzeittherapie, bei der kein Face-to-Face-Kontakt stattfinde. Solche Therapien über Medien würden genutzt, wenn andere Wege, in der Regel vorübergehend, nicht zur Verfügung stünden. Bei dem veröffentlichten Fallmaterial über diese Therapien stellte die Reflexion der Deutung des genutzten Mediums einen zentralen Bestandteil dar. Als Herausforderungen benannte er die Datensicherheit, den Umgang mit der Veränderung des Körperlichen, den Einsatz von Medien bei bestimmten Erkrankungen wie Psychosen, Suchterkrankungen oder Borderline-Erkrankungen sowie den Einfluss, den Medien auf das Schweigen in Psychoanalysen haben könnten.
Rudyk beschrieb die Auseinandersetzung von Psychoanalytiker*innen mit der Digitalisierung exemplarisch anhand zweier Arbeiten von Alessandra Lemma und Elfriede Löchel. Lemma gehe anhand eines Fallbeispiels einer psychoanalytischen Behandlung der Frage nach, wie sich sexuelle Identität und Geschlechtsidentität im Zeitalter von Internet und Smartphone entwickeln, und führe dabei den Begriff des „schwarzen Spiegels“ ein. Da sich Heranwachsende gedrängt fühlten, einen Spiegel jenseits der Elternfiguren zu suchen, nähmen Bildschirme von Monitoren, Tablets oder Smartphones diese Funktion als Spiegel ein, da sie am einfachsten zugänglich und einsetzbar seien. Dieser Spiegel reflektiere aber nicht, er spiegele nicht zurück, sondern projiziere stattdessen intrusiv in den Betrachter hinein. Er »pushe« so Wünsche, Bilder und Empfindungen in Körper und Geist, und zwar ohne dass die Jugendlichen dies überhaupt veranlassten. Der schwarze Spiegel bedeute Unmittelbarkeit und mache eine Vermittlung überflüssig. Vor dem Hintergrund dieser Betrachtung leite Lemma Empfehlungen für Eltern und Psychotherapeut*innen ab.
Löchel beschreibe, dass sich Psychoanalytiker*innen nicht vorrangig für das Manifeste, sondern für die verborgenen, latenten, unbewussten Dynamiken interessierten. Es stelle sich daher die Frage, ob sich angesichts gravierender gesellschaftlicher Veränderungen durch die Digitalisierung auch die Menschen selbst verändern, insbesondere in Bezug auf ihre unbewussten Prozesse. Löchel hebe zudem hervor, dass das Medium wie beispielsweise ein Tablet oder Smartphone, das etwas zur Erscheinung bringe, selbst dazu tendiere unsichtbar zu bleiben, und rückte es damit mit in den Fokus ihrer Betrachtung.
Anhand der Gegenüberstellung der Figuren von „Prometheus und Jesus“ verortete Rudyk die Fragen der Psychoanalyse angesichts der Digitalisierung zwischen den zwei Polen Überwindung der Sterblichkeit durch technischen Fortschritt und Demut gegenüber dem auch zukünftig unvermeidbaren menschlichen Leid.
Als Fazit hielt Rudyk fest, dass aus seiner Sicht die neuen Möglichkeiten durch Digitalisierung für die psychoanalytische Praxis nicht das zentrale Thema seien. Im Zentrum der psychoanalytischen Reflexion und Forschung ständen vielmehr die Fragen nach den Auswirkungen der Digitalisierung auf das Subjekt. Dabei gebe es zum einen eine kulturhistorisch eher kritische Betrachtung, zum anderen trüge die psychoanalytische Forschung, die sich ihrer eigenen Methodik bediene, dazu bei, die Räume zu erweitern, in denen zu den Auswirkungen der Digitalisierung geforscht, gedacht und erfahren werden
Diskussion
Die Teilnehmer*innen beschrieben verschiedene positive Anwendungsbeispiele digitaler Angebote aus ihren Praxisfeldern. Außerdem diskutierten sie, wie der Umgang mit neuen Medien in die Aus- und Weiterbildung integriert werden könnte, welche Haftungsfragen bei digitalen Angeboten für Psychotherapeut*innen in Zukunft relevant seien und wie spezifische Risiken von digitalen Angeboten adressiert werden könnten.
Als aktuelle Herausforderungen beim Einsatz digitaler Angebote wurde die oft fehlende Transparenz der Inhalte thematisiert sowie sich daran anschließende Fragen einer angemessenen Aufklärung. Kritisch diskutiert wurde zudem der Umgang mit Apps, die vergleichsweise kurz auf dem Markt seien, und die schnelle technische Weiterentwicklung, die häufig auch eine erneute Überprüfung der Datensicherheit erforderlich machten.
In der öffentlichen Debatte sei zudem zu hinterfragen, was es gesellschaftlich bedeute, wenn durch technologischen Fortschritt besonders schnelle Heilsversprechungen gemacht würden. Einig war man sich in der Bedeutung des persönlichen Kontakts für die psychotherapeutische Versorgung und der Relevanz der therapeutischen Beziehung für die Psychotherapie, die auch beim Einsatz digitaler Anwendungen bestehen bleibe. Als Haltung der Profession sei es zentral, eine Diskussion über relevante Fragen der Digitalisierung in der Fachöffentlichkeit anzustreben. Es wurde betont, dass in der Profession zwar unterschiedliche Perspektiven auf die Digitalisierung bestünden, diese sich jedoch nicht widersprächen.
Zum Schluss der Veranstaltung fasste BPtK-Präsident Munz zusammen, dass die Digitalisierung in der Psychotherapie die Profession weiter intensiv beschäftigen werde. Der Input durch die Veranstaltung helfe der BPtK, die Sicht der Profession in die aktuell laufenden politischen Prozesse einzubringen. Die BPtK werde sich auch in Zukunft mit der Frage beschäftigen, wie Psychotherapeut*innen dabei unterstützt werden können, wenn sie digitale Gesundheitsanwendungen in der Praxis einsetzen wollen. Hierfür plane die BPtK, notwendige Informationen für Psychotherapeut*innen in Praxis-Infos zusammenzufassen. Abschließend verwies er auf das Innovationsfondsprojekt, das im Januar nächsten Jahres starten werde und eine wichtige Chance darstelle, die Digitalisierung in der Psychotherapie aktiv mitzugestalten.
Veröffentlicht am 11. März 2020